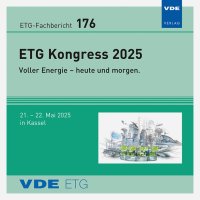Entwicklung eines Zielnetzkonzeptes für das Hochspannungsnetz in Bremen
Conference: ETG Kongress 2025 - Voller Energie – heute und morgen.
05/21/2025 at Kassel, Germany
Proceedings: ETG-Fb. 176: ETG Kongress 2025
Pages: 6Language: englishTyp: PDF
Authors:
Apelt, Dennis; Boenke, Jan Christoph; Kumm, Thomas
Abstract:
Die zukünftigen Entwicklungen im Energiesektor wirken sich erheblich auf die Anforderungen des Netzes in dem Netzgebiet der „wesernetz Bremen GmbH“ aus. Besonders städtische Verteilnetzbetreiber erreichen die mit der Transformation des Energieversorgungssystems verbundenen Herausforderungen gegenwärtig mit enormer Geschwindigkeit. Der Zubau von Wind- und Photovoltaikanlagen sowie die steigenden Bezugsleistungen durch Power-to-X Anlagen sowie die Elektromobilität sind eine wichtige Ursache. Hinzu kommt der Rückgang der Energieerzeugung aus konventionellen Kraftwerken. Um den künftigen Anforderungen gerecht zu werden, soll neben der Verknüpfung zum vorgelagerten Höchstspannungsnetz das Hochspannungsnetz neu strukturiert werden. Das Zielnetzkonzept basiert dabei auf den grundlegenden Anforderungen der VDE-AR-N 4121 [1]. Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden auf der Grundlage der VDE-Vorschrift verschiedene Netzstrukturen entwickelt, die prinzipiell den zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Als Ausgangspunkt diente eine vorab bestimmte Zielnetzstruktur, welche die „Schwerpunkstationen“ (übergeordnete 110-kV-Schaltanlagen) und deren Verbindungen miteinander darstellt. Sie ist in Abbildung 1 dargestellt. Die prognostizierten Leistungen der Lasten und der Erzeugungsanlagen wurden ebenfalls vorab, referenziert auf das Jahr 2045, ermittelt.Für die Entwicklung wird die Zielnetzstruktur in der Netzberechnungssoftware „PowerFactory“ mit all ihren relevanten Modellen und Parametern modelliert und anschließend untersucht. Für die Untersuchung werden zwei Belastungsszenarien betrachtet. Zum einen wird der „Starklastfall“ in dem, die erzeugte Leistung Null ist und die Last die prognostizierten Höchstwerte annimmt, betrachtet. Zum anderen wird der „Einspeisefall“ betrachtet. In diesem beträgt die Last 25 % der Höchstlast und die Erzeugung 100 %. Zunächst werden Teilnetze gebildet, die n-1 sicher über die Transformatoren versorgt werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass keine unzulässigen Kurzschlussleistungen überschritten werden. Aus der Untersuchung ergeben sich drei Varianten mit jeweils drei Teilnetzen. Im Anschluss wird das Redundanzverhalten in der Form des erweiterten n-1-kriteriums untersucht. Dies beschreibt den Ausfall eines Betriebsmittels während einer geplanten Abschaltung eines anderen Betriebsmittels. Dabei wird jede Variante in einer Ring- und in einer Strahlenstruktur untersucht. In keiner Variante soll es im erweiterten n-1 Fall zu einer Überlastung von Kabeln oder Freileitungen kommen. Nach der Untersuchung wurde festgestellt, dass alle sechs Varianten alle notwendigen Bedingungen erfüllen und damit für weitere technische und wirtschaftliche Analysen geeignet sind. Die Variante 3.1 in der Strahlenstruktur stellt die wirtschaftlichste Variante dar, da sie mit 109 km die Variante mit der kürzesten Kabellänge ist. Jedoch ist die Flexibilität in dem Netz sehr gering. Die Variante 3.2 in der Ringstruktur kommt mit 126 km aus. Diese Variante bringt hingegen das höchste Maß an Flexibilität mit sich und ist dadurch die technisch sinnvollste Variante. Abschließend wird die Variante 3.2 in der Ringstruktur mit verschiedenen Starklast- sowie Einspeisefällen untersucht. Sie unterscheiden sich dabei im Leistungsfaktor, dieser variiert zwischen den normativen Grenzen von 0,9 induktiv und 0,9 kapazitiv.